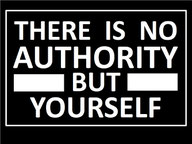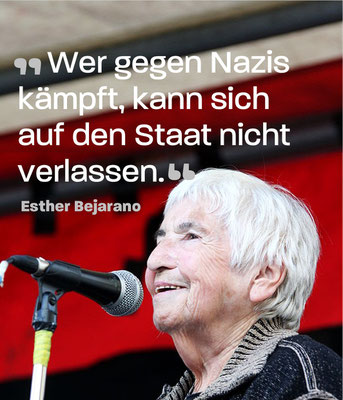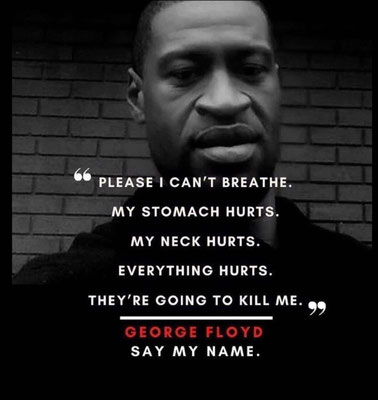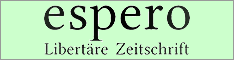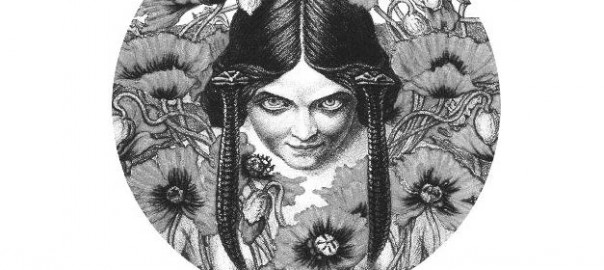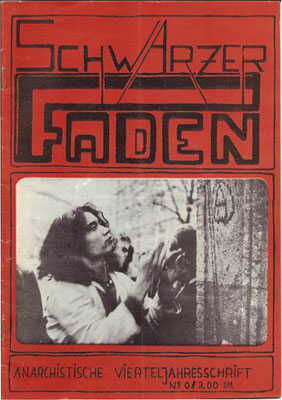Byung Chul-Han - Hoffnung.
Hoffnung?
Wer hofft handelt kühn und lässt sich nicht beirren
von der Jähe und Härte des Lebens.
Der Hoffnung wohnt jedoch etwas Kontemplatives inne.
Sie beugt sich vor und horcht. Ihre Empfänglichkeit
macht sie zart, verleiht ihr Schönheit und Anmut.
Das hoffende Denken ist nicht optimistisch. Im Ge-
gensatz zur Hoffnung fehlt dem Optimismus jede
Negativität. Er kennt weder Zweifel noch Verzweiflung.
Die schiere Positivität ist sein Wesen.
Er ist davon überzeugt, dass die Dinge sich zum Guten
wenden. Für den Optimisten ist die Zeit geschlossen.
Die Zukunft als unabgeschlossener Möglichkeitsraum
ist ihm unbekannt.
Nichts ereignet sich. Nichts überrascht ihn.
Die Zukunft erscheint ihm verfügbar. Der eigentlichen
Zukunft aber wohnt die Unverfügbarkeit inne.
Der Optimist blickt aber nie in die unverfügbare Ferne.
Er rechnet nicht mit dem Unerwarteten oder Unberechenbaren.
Im Gegensatz zum Optimismus, dem nichts fehlt,
der nicht unterwegs ist, stellt die Hoffnung eine Such-
bewegung dar. Sie ist ein Versuch, Halt und Richtung zu
gewinnen. Dabei stößt sie auch ins Unbekannte, ins
Unbegangene, ins Offene, ins noch nicht Seiende vor,
indem sie über das Gewesene, über das bereits Seiende
hinausgreift. Sie hält auf das Ungeborene zu. Sie macht
sich auf zum Neuen, zum ganz Anderen, zum nie Dagewesenen.
Der Optimismus muss nicht erst errungen werden.
Er ist ganz selbstverständlich und fraglos da wie die
Körpergröße oder unveränderliche Eigenschaften einer
Person: "So ist der Optimismus an seine Heiterkeit gekettet
wie der Galeerensträfling an sein Ruder - eine ziemlich
trostlose Aussicht."
Der Optimist braucht keine Gründe für seine Haltung anzugeben.
Die Hoffnung hingegen ist nicht selbstverständlich vorhanden.
Sie erwacht.
Des Öfteren muss sie eigens herbeigerufen, beschworen werden.
Im Gegensatz zum Optimismus dem jede Entschlossenheit fehlt,
zeichnet die aktive Hoffnung ein Engagement aus. Der Optimist
handelt nicht eigens. Mit der Handlung ist immer ein Risiko
verbunden. Der Optimist aber riskiert nichts.
Der Pessimismus unterscheidet sich nicht grundsätzlich vom
Optimismus. Er ist sein spiegelbildliches Gegenstück.
Auch für den Pessimisten ist die Zeit geschlossen.
Er ist eingeschlossen in der "Zeit als Gefängnis".
Der Pessimist lehnt alles rundweg ab, ohne Erneuerung anzu-
streben oder sich auf mögliche Welten einzulassen.
Er ist genauso starrsinnig wie der Optimist.
Sowohl der Optimist als auch der Pessimist sind möglichkeits-
blind. Sie kennen kein Ereignis, das dem Lauf der Dinge
eine überraschende Wendung geben würde.
Sie verfügen über keine Fantasie des Neuen, über keine
Leidenschaft für das nie Dagewesene.
Wer hofft, setzt auf Möglichkeiten, die über das "schlecht
Vorhandene" hinausweisen.
Die Hoffnung befähigt uns dazu, aus der geschlossenen Zeit
als Gefängnis auszubrechen.
Die Hoffnung ist auch vom "positiven Denken" und von der
"positiven Psychologie" abzugrenzen. In Abwendung von der
Psychologie des Leidens versucht die positive Psychologie,
sich ausschließlich mit Wohlbefinden und Glück zu beschäftigen.
Negative Gedanken sind unverzüglich durch positive Gedanken
zu ersetzen.
Das Ziel der positiven Psychologie ist es, das Glück zu
vermehren. Negative Aspekte des Lebens werden komplett aus-
geblendet. Die Welt wird wie ein großes Warenhaus vorgestellt,
in dem wir alles bekommen, was wir bestellen.
Der positiven Psychologie zufolge ist jeder alleine fürs eigene
Glück verantwortlich. Der Positivitätskult führt dazu, dass die
Menschen, denen es schlecht geht, sich selbst beschuldigen,
statt die Gesellschaft für ihr Leid verantwortlich zu machen.
Verdrängt wird, dass das Leiden immer gesellschaftlich vermittelt
ist. Die positive Psychologie psychologisiert und privatisiert es.
Sie lässt den gesellschaftlichen Verblendungszusammenhang, der
das Leiden verursacht, unangetastet bestehen.
Der Positivitätskult vereinzelt die Menschen, macht sie egoistisch,
baut die Empathie ab, weil die Menschen sich nicht mehr für das Leid
Anderer interessieren. Jeder ist nur noch mit sich sich selbst,
mit eigenem Glück, mit eigenem Wohlbefinden beschäftigt.
Der Positivitätskult im neoliberalen Regime entsolidarisiert die
Gesellschaft.
Im Gegensatz zum positiven Denken wendet sich die Hoffnung von den
Negativitäten des Lebens nicht ab. Sie bleibt eingedenk.
Außerdem vereinzelt sie die Menschen nicht, sondern verbindet und
versöhnt sie.
Das Subjekt der Hoffnung ist ein Wir.
BYUNG CHUL-HAN - DER GEIST DER HOFFNUNG WIDER DIE GESELLSCHAFT DER ANGST.
Seite 15-18.
Angstvoll blicken wir in eine düstere Zukunft. Überall fehlt es an Hoffnung.
Und das Leben verkümmert zum Überleben.
Dagegen beschwört der Philosoph Byung-Chul Han mit aller Kraft den Geist der Hoffnung.
Seit geraumer Zeit werden wir permanent mit apokalyptischen Szenarien konfrontiert:
Pandemie, Weltkrieg und Klimakatastrophe.
Der Weltuntergang oder das Ende der menschlichen Zivilisation wird heraufbeschworen.
Angst und Ressentiments aber schüren Egoismus und Hass - mit der Folge,
dass in unserer Gesellschaft Solidarität, Freundlichkeit und Empathie erodieren
und letztlich die Demokratie selbst gefährdet ist.
Byung-Chul Han entwickelt gegen das Klima der Angst eine überzeugende Philosophie der Hoffnung,
die über die gegenwärtige Krise hinaus Gültigkeit hat.